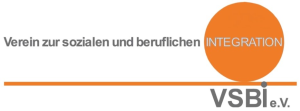Situation pflegender Angehöriger
Hier finden Sie einen Text mit grundlegenden Informationen zur psycho-sozialen Situation pflegender Angehöriger.
1. Zahlen & Fakten
Ein Ihnen nahestehender Mensch ist erkrankt oder alt und pflegebedürftig. Für Sie ist es eine Selbstverständlichkeit, ja ein Bedürfnis, ihm/ihr zu helfen.
Die Bewältigung langfristiger Pflegebedürftigkeit ist eine neue Herausforderung moderner Gesellschaften vor allem vor dem Hintergrund von Frauenerwerbstätigkeit, Arbeitsmobilität und einer zunehmenden Zahl von Singlehaushalten. Viele Menschen in Deutschland werden von Angehörigen und Ehrenamtlichen betreut ohne die Unterstützung von Pflegediensten. Mehr als 32% aller Hauptpflegepersonen sind älter als 65 Jahre und gehören somit selbst zur älteren Generation. Die Hälfte der Hauptpflegepersonen ist zwischen 40 bis 64 Jahre alt, nur 11% sind jünger als 39 Jahre. Die Angehörigenpflege ist weiblich, Dreiviertel der pflegenden Angehörigen sind Frauen (27% Männer), wobei Männer hauptsächlich die Pflege ihrer Ehefrauen übernehmen, wenn sie schon selbst im Ruhestand sind. Dabei fühlen sie sich nicht moralisch verpflichtet ihre Frau zu pflegen, sondern sie tun dies aus freien Stücken, weil sie eine erfüllte Partnerschaft und ein eher rundes Berufsleben hinter sich haben (Langehennig 2012). Der Anteil pflegender Söhne steigt (z. Zt. 10%), pflegende Schwiegersöhne gibt es jedoch praktisch nicht. Von den pflegenden Angehörigen sind 32% berufstätig und 87% haben zusätzlich einen eigenen Haushalt. Die Hälfte der pflegenden Angehörigen klagen über eine hohe Belastung (BMAS 1996; Meyer 2006; SOEP 2010).
Zwei Drittel der Frauen geben an, die Pflege würde sie psychisch stark oder sehr stark bedrücken und auch ihre Partnerschaft belasten (R+V-Studie zu Frauen und Pflege 2012). Pflegende Männer und jüngere pflegende Angehörige fühlen sich durch die Pflege weniger stark belastet als ältere pflegende Angehörige und Frauen (Köhler 2013). Als besondere Gruppe unter den pflegenden Angehörigen sind minderjährige Kinder und Jugendliche zu nennen, die ihre kranken Eltern oder Geschwister pflegen, um die Familie aufrecht zu erhalten (Metzing 2012). Die meisten Menschen wünschen sich eine Pflege zu Hause. Dies entspricht dem gesellschaftlichen Ziel der Selbstständigkeit und dem Grundsatz ambulant vor stationär. Durch den demographischen Wandel nimmt der Bedarf häuslicher Unterstützung zu (Landtag NRW 2005).

Abbildung 4: Aufgaben pflegender Angehöriger (eigene Darstellung in Anlehnung an Gutzmann & Zink, 2005, S. 150-153)
Der klassische Begriff der familiären Pflege wandelt sich. Durch sich verändernde Familienverhältnisse sind pflegende Angehörige nicht nur direkte Familienmitglieder wie Ehepartner*innen, Kinder, Schwiegertöchter und Schwiegersöhne, Enkel, sondern auch zunehmend Freund*innen und Nachbar*innen. Der Entschluss eine/n Angehörigen zu pflegen ist von den Möglichkeiten und der Familienbeziehung geprägt.
Der Grad der individuellen Belastung des pflegenden Familienmitglieds hängt vom Verhältnis zwischen dem persönlichen Belastungsempfinden und den als belastend empfundenen Faktoren ab. Das jeweilige Belastungserleben und die Belastungsbewältigung sind subjektiv und individuell und werden vom Kontext sowie den Motiven beeinflusst (Gräßel 1998; Schnepp 2002).